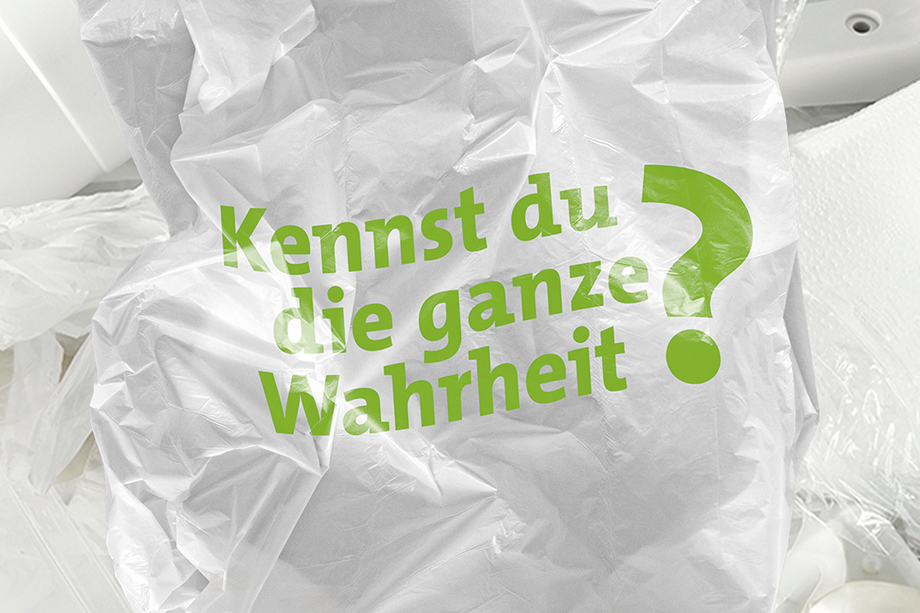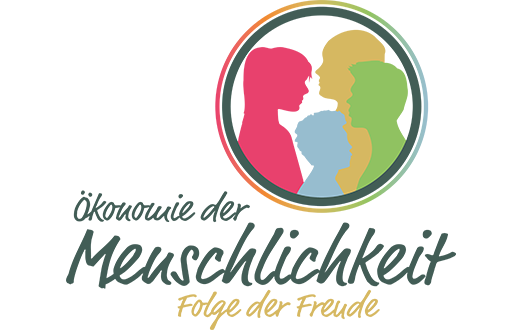Kunststoff verschmutzt die Meere und den Boden. Mikroplastik vergiftet Mensch und Tier. Dass Plastik ökologisch problematisch ist, ist weitreichend bekannt. Die Alternativen sind vielfältig: Sogenanntes „Bio-Plastik“ soll konventionelle Plastikverpackungen ersetzen, manche Hersteller setzen auf Glas oder Nachfüllstationen. Doch optimal sind auch diese Lösungen nicht.
Der erste Kunststoff wurde 1862 in London präsentiert. Seitdem hat das Material Erfolgsgeschichte geschrieben. Kein Wunder, immerhin ist es so flexibel und langlebig wie kaum ein anderer Stoff. Dabei sind die Produktionskosten vergleichsweise gering. Allerdings verschmutzt Plastik die Umwelt, weil es nicht zerfällt. „Zu unserer Verpackung, vor allem zur Plastikverpackung, machen wir uns fast täglich Gedanken“, sagt CULUMNATURA Geschäftsführer Willi Luger.
„Bio-Plastik“: Die Lösung?
Die Antwort vorneweg: Nein, sogenanntes „Bio-Plastik“ ist keine Alternative. Weder bio-basierter noch bio-abbaubarer Kunststoff kann als umweltfreundliche Option bezeichnet werden. Bio-basierte Kunststoffe werden heutzutage hauptsächlich als PET und PE im Verpackungsbereich eingesetzt. Deren biogene Ausgangsmaterialien werden zum Beispiel aus Zuckerrohr, Mais oder Kartoffeln gewonnen. Das kostet wertvolle Ressourcen. Die Gruppe der bio-abbaubaren Kunststoffe wiederum soll unter definierten Bedingungen durch Mikroorganismen abgebaut werden. Diese abbaubaren Kunststoffe können zusätzlich bio-basiert sein, müssen es aber nicht. Sie können also auch auf Erdöl basieren.
Zwar wird den bio-abbaubaren Kunststoffen die Kompostierbarkeit bescheinigt, in der Praxis sieht es aber anders aus: Nach offiziellen Prüfkriterien müssen die Kunststoffe nach zwölf Wochen bei 60 Grad Celsius zu 90 Prozent abgebaut sein. Jedoch bleibt dem Müll in den meisten Kompostieranlagen nur etwa vier Wochen Zeit, zu verrotten. „Am Ende dieses Abbaus bleiben nur Wasser, Kohlendioxid und mineralische Zusatzstoffe zurück, es entstehen aber keine humusbildenden Stoffe. Zusätzlich wird Wärme frei, die ungenutzt für den weiteren Recyclingprozess verloren geht. Um den nächsten Abfallbeutel herzustellen, muss also wieder Energie von außen zugeführt werden. Damit ist dieser Vorgang genau genommen keine Kompostierung, sondern eine reine Entsorgung“, erklären die Autoren des Plastikatlas 2019 von Global 2000 und der Heinrich-Böll-Stiftung.
Flächen müssen gerodet werden
Für den Einsatz bio-basierter und bio-abbaubarer Kunststoffe wird oft als Argument angeführt, dass sie nach den aktuell vorliegenden Ökobilanzen bezüglich Klimawirkung besser abschneiden als vergleichbare herkömmliche Kunststoffe. „Allerdings zeigt sich, dass die positive Bilanz wieder zunichte gemacht wird – durch die Versauerung und die Überdüngung von Böden und Gewässern, die durch den überwiegend konventionellen Anbau von Rohstoffpflanzen für bio-basierte Kunststoffe verursacht werden“, so die Kritik von Global 2000. Zudem würden die Ökobilanzen nicht berücksichtigen, wie sich die direkten und indirekten Änderungen der Landnutzung sowie der Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen auswirkt. Auch die Folgen für die Biodiversität in den Anbaugebieten von „Bio-Kunststoffen“ seien noch nicht ausreichend erforscht.
Zu den Anbaugebieten zählt z.B. Brasilien, wo schon jetzt wertvolle Flächen für die Landwirtschaft gerodet werden. „Der Druck auf die weltweiten Ackerflächen würde sich weiter erhöhen. Schon heute führt dieser Druck in einzelnen Regionen zu Wasserknappheit, Artensterben, Wüstenbildung und zum Verlust natürlicher Lebensräume. Die Ausweitung des Anbaus von Agrarrohstoffen ist keine Option, um umweltverträgliches Plastik herzustellen“, lautet dazu die Meinung von Global 2000.
Für DI Dr. Ines Fritz vom Institut für Umweltbiotechnologie der Universität für Bodenkultur Wien, ist „Bio-Plastik“ ebenfalls die falsche Antwort: „Sogenannter ‚Bio-Kunststoff‘ kann durchaus als Greenwashing bezeichnet werden. Denn für die Herstellung werden wertvolle Bioressourcen verbraucht. Gerade wenn es um Einwegprodukte geht, sind diese Materialien ethisch bedenklich.“
Glas und Nachfüllstationen
Einweg, das ist das Stichwort, wenn es um Verpackungen aus Glas geht. Denn Glas hat den bedeutenden Vorteil, dass es eben kein Einwegprodukt ist. Fritz: „Je öfter ich ein Produkt oder eine Verpackung verwenden kann, desto kleiner ist der ökologische Schaden.“ Verwendet man Glas allerdings nicht mehrmals, dann stellt sich heraus, dass der Energieaufwand für die Produktion und den Transport in keiner Relation zum Nutzen stehen. Warum Nachfüllstationen gerade für NATURkosmetik problematisch sind, erklärt Willi Luger: „Da wir keine synthetischen Konservierungsstoffe verwenden, muss gerade im Kosmetik- und Hygienebereich mit größter Sorgfalt gearbeitet werden. Aus diesem Grunde ist es nicht möglich, unsere Produkte mit Nachfüllstationen anzubieten. Hier müsste dann wieder sehr viel hochkonzentrierte Konservierung eingesetzt werden.“
Das ultimative Verpackungsmaterial gibt es also zurzeit noch nicht. „Die am wenigsten bedenkliche Verpackung ist jene, die ich 25 Jahre und länger verwende. Das ist nicht immer möglich. Letztlich muss der Konsument entscheiden, zu welcher Verpackung er greift und abwägen, welches Material am sinnvollsten ist“, appelliert Fritz an die Vernunft jedes Einzelnen. So gilt es auch, Kunststoff wertzuschätzen, wo er unverzichtbar ist und achtsam damit umzugehen: Also keine halbvollen Packungen wegzuwerfen und die Verpackung am besten gereinigt im dafür vorgesehenen Müll zu entsorgen.
VON KARIN BORNETT (www.karinbornett.at)